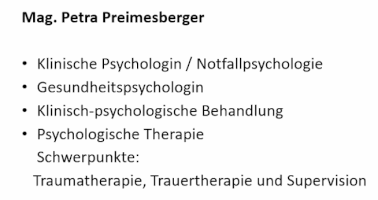- Akute Belastungsreaktionen von Einsatzkräften
- "Das Messi-Syndrom"
- Gewaltprävention in der Pflege
- "Psychische Erste Hilfe und Krisenintervention"
- "Suizid und Suizidprävention"
- Seminar "Tod und Trauer in der psychologischen Beratung"
- Webinar "Tod und Trauer in der (psychologischen) Beratung
- "Tod und Trauer" bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
- "Traumafolgestörungen"
- Informationen, links & Bücher

Akute Belastungsreaktionen bei Einsatzkräften
besondere Einsätze erfordern besondere Nachbetreuung
Für Einsatzorganisationen biete ich KOSTENLOSE Vorträge und Debriefings nach besonders belastenden Einsätzen und / oder als Präventionsmaßnahme an.
Dauer - nach Wunsch auf Ihrer Dienststelle.
(*ev. fallen Fahrtkosten an, wenn Ihre Dienststelle weiter weg ist)
AKUTE BELASTUNGSREAKTIONEN als Folge eines belastenden Erlebnisses
nicht immer muss es ein "traumatisches" Ereignis sein, manchmal reichen auch "kleinere" Traumatas, sprich "Belastende Ereignisse" um körperliche und psychische Reaktionen zu spüren.
Ich versuche es hier, an Beispielen aus dem Rettungsdienst zu erklären:
Ein „belastendes Ereignis“ definiert Gruber (2012) wie folgt: „Jedes Ereignis mit so starker Einwirkung auf die Psyche, dass es normale Verarbeitungsfähigkeiten eines einzelnen oder einer Gruppe überwältigt.“
Belastende Ereignisse werden nach Gruber (2012) bestimmt durch:
· plötzliches und unvermitteltes Eintreten
· das Erleben von Hilflosigkeit
· den Grad der Betroffenheit/Intensität
· den Grad der Identifikation.
Einsatzkräfte können tagtäglich mit belastenden Ereignissen konfrontiert werden ohne Folgewirkungen zu zeigen. Als Schutzmechanismen sind hier vor allem eine gute Aus – und Weiterbildung zu nennen, sowie das Vertrauen in die Kollegen, in das System und in die zu verwendende Einsatzmitteln. Versagt einer dieser Schutzmechanismen, beispielsweise wenn eine Einsatzkraft bei einem bestimmten Verletzungsmuster nicht weiß, wie diese Verletzung zu versorgen ist oder wenn für die Beatmung keine geeignete Maske zur Verfügung steht, so kann das die Einsatzkraft dermaßen belasten, dass entweder bereits während des Einsatzes oder nach dem Einsatz (eventuell sogar zeitverzögert ein bis zwei Tage nach dem Ereignis) akute Belastungsreaktionen (ABR) in Form von Dissoziationen auftreten.
Solche dissoziativen Zustände sind nach Fiedler (2013) folgendermaßen charakterisiert:
· Beeinträchtigung der Wahrnehmung
· Derealisationserlebnisse
· Depersonalisationserlebnisse
· Emotionale Taubheit
· Dissoziative Amnesie
Sie werden von Fiedler (2013) als „normale menschliche Reaktionsweisen auf extrem abnorme Situationen“ dargestellt.
Als weitere Reaktionen führt Fiedler (2013) folgende Symptome an:
Übererregung
Desorganisation
Erstarrung
Fluchttendenz
Hilflosigkeitsgefühl
Angstgefühle
Als Einsatzkraft ist man ausgebildet, um im Ernstfall rasch und effizient zu helfen. Ist diese Hilfe nicht möglich, weil man noch nicht zum Patienten darf, keine geeigneten Einsatzmittel zur Verfügung hat oder man für den Patienten nichts mehr tun kann, belastet das vor allem Einsatzkräfte extrem. Diese „Hilflosigkeit“ ist auch in den Supervisionsgesprächen oft ein sehr zentrales Thema und wird somit der Auslöser für das Entstehen von akuten Belastungsreaktionen (ABR) oder sogar einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
Oliver Schubbe (2006) expliziert an dieser Stelle: „ Ein Erlebnis kann zu einem psychischen Trauma führen, wenn sich eine Person einer für sie bedeutsamen Situation wehrlos, hilflos und unentrinnbar ausgesetzt fühlt und diese mit ihren bisherigen Erfahrungen nicht bewältigen kann“
Ein solches Erlebnis wird von unserem Gehirn nicht im explizitem Gedächtnis gespeichert, sondern im impliziten Langzeitgedächtnis, welches auch als Traumagedächtnis bezeichnet wird, abgelegt. Hier wird das Erlebte in die einzelnen Sinneseindrücke zerlegt und jeder Sinneseindruck wird für sich extra abgespeichert, d.h. es steht oftmals kein „ganzes“ Bild für die Bearbeitung zur Verfügung, sondern unser Gehirn reproduziert nur Fragmente in Form von einzelnen Bildern und / oder anderen Sinneseindrücken. Dieser Prozess kann auch als Schutzmechanismus angesehen werden, da es in der Akutsituation sonst zu einer psychischen Überforderung kommen könnte.
Ziel jeder Traumatherapie muss es demnach sein, diese unterschiedlich abgespeicherten impliziten Erinnerungen in einer sicheren Umgebung wieder zu einer in sich geschlossenen Erinnerungsgeschichte im explizitem Gedächtnis zu vereinen, damit die Verarbeitung bzw. die Integration des Erlebten geschehen kann.
Beispiel:
(aus Datenschutzgründen wurde der Einsatz stark verändert)
Folgender Anruf geht in der Landesleitstelle ein: „Bitte kommen sie schnell, meine Frau hat sich verbrannt!“ Der Anrufer nennt noch Name und Adresse und legt auf.
Die Rettungsmannschaft stellt sich auf eine Verbrennung bzw. Verbrühung ein und fährt mit Folgetonhorn und Blaulicht zum Einsatzort. Am Einsatzort präsentiert sich folgende Situation: durch die Explosion einer Gasflasche hat sie die Kleidung einer Frau entzündet. Sie läuft „wie eine lebende Fackel“ im Garten herum, bis sie schließlich umfällt aber noch Vitalfunktionen zeigt.
Die Mannschaft ist rat – bzw. hilflos. Was ist hier zu tun? Was kann man noch tun? Das Entsetzen über das Ereignis ist den Kollegen auch noch Tage später anzusehen. Für so einen Einsatz wurden sie nicht ausgebildet und können nur noch die Ankunft des Notarztes abwarten, da sie keine sanitätstechnischen Maßnahmen setzen können.
Diese Hilflosigkeit und auch das Entsetzen über das Erlebte führte bei einer Person der Rettungsmannschaft zur Ausbildung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Noch vier Monate nach dem Einsatz tauchten immer wieder Bilder von diesem Geschehen auf, immer wieder hatte sie den Geruch nach verbranntem Fleisch in der Nase, klagte über Schlaf – und Konzentrationsstörungen und konnte den Rettungsdienst nicht mehr versehen.
Aber es müssen nicht immer nur jene Einsätze, welche wir als sehr belastend definiert haben, zur Entstehung von akuten Belastungsreaktionen führen. Manchmal reicht auch schon ein kleines Detail eines Einsatzes, welches uns an unsere eigene Geschichte bzw. an einen anderen Einsatz erinnert und wir werden den Einsatz nicht mehr los, d.h. Bilder des Einsatzes erscheinen immer wieder vor unserem geistigen Auge, Geräusche drängen sich auf, Gerüche bleiben in unserer Nase hängen und manchmal gehen diese Erinnerungseindrücke auch mit körperlichen Empfindungen einher.
Beispiel:
Eine erfahrene Kriseninterventionsmitarbeiterin erzählte mir von einem Einsatz, in dem sie eine ältere Dame betreute, deren Gatte soeben verstorben war. Die Dame war nicht allzu sehr belastet, da ihr Gatte bereits seit Jahren an einer lebensbedrohenden Erkrankung laborierte und sie daher für ihn den Tod eher als Erlösung von seinem Leiden ansah.
Gemeinsam mit der Gattin bettete die Kriseninterventionsmitarbeiterin den Verstorbenen auf die Couch, zündete Kerzen an und lies die Frau mit ihrem verstorbenen Mann alleine, damit sie sich nochmals in aller Ruhe von ihm verabschieden konnte. Als die Bestattung den Leichnam abgeholt hatte, trank die Kollegin noch einen Tee mit der Frau und verabschiedete sich mit dem Wissen, dass die erwachsenen Kinder in nächster Zeit bei der Mutter eintreffen werden.
Alles in allem war dies kein „belastender“ Einsatz. Trotzdem bemerkte die Kollegin in den nächsten Tagen eine große Unruhe in sich, Schlafstörungen machten sich breit und es kamen ihr immer wieder Bilder dieses Einsatzes in den Sinn. Da sie keine Erklärung dafür hatte, vereinbarte sie mit mir einen Supervisionstermin.
Mit Hilfe von „Brainspotting“ kam sie während des Bearbeitungsprozesses zu jenem Traumaknoten (Kern des Traumanetzwerkes, das durch eine belastende Erinnerung entsteht), welcher mit ihrer eigenen Geschichte verwebt ist: am Unterarm des Verstorbenen war eine KZ- Nummer eintätowiert. Eine ähnliche Tätowierung trug auch ihr Großvater, von dem sie sich nicht verabschieden konnte als er im Sterben lag, da sie zu dieser Zeit im Ausland studierte. Dieses Nicht-Abschiednehmen- können vom geliebten Großvater war dann für sie das zentrale Thema. Erst als ihr die Bearbeitung dieses Themas gelungen war, verschwanden auch die Bilder vom Einsatz.
Wie bereits erwähnt, führt zum Glück nicht jedes belastende Ereignis zu einer PTBS. So liegt die Ausbildung einer PTBS bei Einsatzkräften- trotz des Risikos von 100 Prozent eine traumatische Situation im Einsatz erleben zu müssen- lediglich bei 18,2 Prozent. (Im Vergleich: In der Zivilbevölkerung liegt das Risiko in eine traumatische Situation zu kommen bei 18,1 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus eine PTBS entwickelt liegt bei 1,2 Prozent).
Woran es jetzt liegt, dass manche Menschen nach einem traumatischen Erlebnis eine PTBS entwickeln und andere wieder nicht, versucht die Traumaforschung mit verschiedenen Modellen zu erklären ( z.B. Foa und Kozak, Horowitz, Kolk und Fiesler).
Kommt es durch ein belastendes Ereignis zu einer akuten Belastungsreaktion (ABR) bzw. zur Ausbildung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), gibt es wie eingangs erwähnt Methoden der Traumatherapie, welche hier sehr effektiv eingesetzt werden können.
Neben zahlreichen Therapiemethoden seien hier zwei Methoden besonders hervor zu heben:
· Zum einen das von Francine Shapiro entwickelte Modell Eye Movement Desensitization (and) Reprocessing (EMDR) und
· dem sich daraus entwickelten Ansatz von David Grand des Brainspottings (BSP)
Dem an EMDR interessierten Leser sei hier das Fachbuch von Oliver Schubbe (2013) „Traumatherapie mit EMDR. Ein Handbuch für die Ausbildung“ ans Herz gelegt. Demnach wird laut Schubbe (2013) EMDR als Möglichkeit einer „(…) psychologischen Interventionen bezeichnet, die eine beschleunigte Verarbeitung traumatischer, eingefrorener Erinnerungen und eine Auflösung starrer Verhaltensmuster möglich macht. Die Neubearbeitung von belastenden Erinnerungen und mit ihnen verbundenen unangepassten Kognitionen erfolgt dadurch, dass die Klientin sich zeitlich auf ihr inneres Erleben beim Fokusieren der belastenden Vorstellungen konzentriert und ihre Aufmerksamkeit auf einen äußeren Wahrnehmungsreiz (die bifokale Stimulierung) richtet.
Entscheidend für die Effektivität des dadurch ausgelösten inneren Prozesses ist, dass es dem Klienten gelingt, sich in eine Beobachterrolle zu begeben, von der aus er alles, was mit ihm geschieht, wahrnehmen und wieder gehen lassen kann.
Die aktive und intensive Begleitung dieses inneren Prozesses des Klienten macht eine therapeutische Einzelarbeit notwendig.“
Diese bifokale Stimulierung kann durch das sogenannten „Tappen“ (abwechselndes Berühren - zum Beispiel der Knie des Klienten) oder durch optische Reize erfolgen. So bewegt der Therapeut seinen Finger in gleichmäßigen Bahnen von links nach rechts und der Klient folgt dieser Bewegung nur mit den Augen und hält dabei seinen Kopf still. Ebenso können bilaterale Geräusche angewendet werden.
Die Wirkweise des EMDR kann am besten mit dem Accelerated Information Processing (AIP) Modell von Shapiro erklärt werden: „Wenn ein Trauma stattfindet, scheint das Nervensystem die Erinnerung an diese Situation mit allen Bildern, Gedanken und Gefühlen „einzufrieren“. Die Augenbewegungen, die wir im EMDR anwenden, scheinen den Block im Nervensystem aufzuheben und zu ermöglichen, die Erlebnisse zu verarbeiten. Dies geschieht evtl. Auch im REM – oder Traumschlaf – die Augenbewegungen helfen nichtbewusstes Material zu verarbeiten. Es ist wichtig sich klar zu sein, dass es Ihr eigenes Gehirn ist, das die Heilung herbeiführt und Sie darüber Kontrolle haben“.
EMDR ist eine sehr stark strukturierte Methode zur Traumabehandlung. In acht Schritten begleitet der Therapeut den Klienten, wobei er sich als Therapeut eher zurück nimmt um den Prozess der Traumaverarbeitung nicht zu stören.
Die Methodik des Brainspotting
Der New Yorker Psychoanalytiker David Grand behandelte jahrelang traumatisierte Klienten mittels EMDR, Somatic Experiencing (SE) und der Psychoanalyse. Diese Dreierkombination bezeichnete Grand als „Natural Flow EMDR“, er publizierte diese Methode elf Tage vor den Anschlägen auf das World Trade Center („9/11- Katastrophe“) in Buchform. Über achtzehn Monate hinweg behandelte er Menschen, welche in irgendeiner Art und Weise in diese Anschläge involviert waren sehr erfolgreich mit dieser integrativen Therapie. Durch diese sehr intensive Arbeit mit traumatisierten Menschen „entdeckte“ er die Methode des Brainspottings. Mit Brainspot definiert er einen Punkt im Raum (festgemacht an das Ende eines Zeigestabes oder einem Merkmal an der Wand), an dem der Klient – im Zuge der kognitiven Beschäftigung mit dem traumatischen Ereignis – eine körperliche Reaktion zeigt. Dies kann ein Hüsteln, Augenzwinkern, Munderverziehen oder Sonstiges sein.
Über diesen Brainspot wird ein intensiver Verarbeitungsprozess im Traumaknoten eingeleitet und der Therapeut begleitet den Klienten durch den Prozess, bis die Belastung verschwunden ist. Für David Grand (2014) stellen die Augen somit eine Erweiterung des Gehirns dar. Die lichtintensiven Nervenzellen leiten die Aktionspotenziale an die Sehrinde und ermöglichen so die verschiedenen Aspekte der visuellen Umgebung zu erfassen, die Größe, Farbe, Entfernung und Bewegung von Objekten.
Die Kernaussage „Wohin wir sehen, beeinflusst unsere Gefühle“ wird hier direkt umgesetzt und kann auch dazu benutzt werden, „Ressourcenpunkte“ zu definieren.
Grand (2014) schreibt dazu: „Genauso, wie die Augen auf natürliche Weise die äußere Umwelt nach Informationen scannen oder absuchen, können wir sie auch benutzen, um unsere innere Welt – unser Gehirn – nach Informationen abzusuchen.
Brainspotting nutzt unser Gesichtsfeld, um den „Scanner“ auf uns selbst zu richten und unser Gehirn so zu lenken, dass es verloren gegangene innere Informationen wiederfindet. Indem wir unseren Blick auf eine bestimmte äußere Stelle gerichtet halten, richten wir den Fokus des Gehirns auf jene innere Stelle, wo das Trauma gespeichert ist. So fördern wir die tiefgreifende Verarbeitung, die zur Lösung und Befreiung von dem Trauma führt.“
Ich arbeite inzwischen seit mehr als einem Jahr mit dieser Methode und kann die Effektivität von Brainspotting nur bestätigen.
Beispiel:
Eine Kollegin bricht während der Ausbildung zur Rettungssanitäterin bei der CPR am Modell mit einer Bluthochdruckkrise zusammen und wird mir nach ambulanter Abklärung im Spital vom Lehrbeauftragten geschickt. Sie berichtet, dass sie als Volontärin vor wenigen Tagen eine reale Reanimation einer ca. 92jährigen Dame hatte. Diese Reanimation war erfolglos und für sie aber nicht weiter tragisch, daher wundert sie sich umso mehr, warum ihr diese erfolglose Reanimation bei der Übungs-CPR plötzlich diese Bluthochdruckkrise verursachte.
Die Behandlung der Kollegin führte ich anschließend nach dem Standardprotokoll von Schubbe (2014) durch:
· Das Narrative (Ausgangssituation: Was ist passiert?)
· Belastungsgrad (SUD = Subjective Units of Disturbande-Skala. Dies ist eine Skala von 0 = keine Belastung bis 10 = höchste Belastung)
· Körpersensation (wo spüren Sie diese Belastung momentan im Körper?)
· Blickrichtung oder Körperhaltung lokalisieren = Brainspot eruieren
· Start des Prozesses
In der ersten „eingestellte“ Sequenz beschrieb die angehende Sanitäterin die Reanimation der alten Dame, während sie die Spitze des Zeigestabes mit ihren Augen fixierte und so in einen inneren Entspannungszustand ging. Ich ließ sie einige Zeit (ca. 30 Sekunden) in diesem Zustand und fragte dann, als ich merkte, dass ihre Augenlider zu „flattern“ begannen, welches Bild jetzt in ihr aufgetaucht ist. Sie wirkte sehr verwirrt, weil sie plötzlich in einer ganz anderen Szene war – in einem Verkehrsunfall, welcher vor über zwanzig Jahren passierte und zu dem sie als Ersthelferin dazukam. Bei diesem Unfall verstarb ein sehr guter Freund im Alter von sechzehn Jahren. Nachdem sie mir das in knappen Worten geschildert hatte, bat ich sie wieder, sich auf den Punkt zu konzentrieren und „dem Prozess zu vertrauen, alle Bilder, welche auftauchen, sind in Ordnung“. Nachdem wir auf diese Art und Weise diesen Verkehrsunfall, die damit verbundene Hilflosigkeit und noch andere Themen bearbeitet hatten, verringerte sich der Ausganswert auf SUD 1.
Für mich ist es sehr spannend zu beobachten, dass sich die ursprüngliche Ausgangsituation meist sehr rasch ändert und eine andere, belastende Erinnerung auftaucht, von der die meisten Kollegen der Meinung waren, dieses Ereignis entweder bereits gut verarbeitet oder erfolgreich verdrängt zu haben, d.h. ein früheres, nicht adäquat verarbeitetes und integriertes Traumata bricht durch eine aktuelle, belastende Situation wieder durch. In der Fachsprache spricht man hier von einer "Affektbrücke".
Dass dies so oft zu beobachten ist, darf nicht verwundern, finden wir ja gerade in helfenden Berufen vermehrt Menschen, welche eigene Erfahrungen mit Trauma, Missbrauch oder den Verlust eines nahestehenden Menschen mitbringen. So haben sie in ihrem Leben selbst die überwältigenden Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit erleben müssen.
Für mich ist inzwischen Brainspotting die erste Wahl in der Behandlung von (akut) traumatisierten Menschen.
Grand (2014) und Schubbe (2014) sehen Brainspotting nicht als eigenständige Therapie an, sondern vertreten die Meinung, dass Brainspotting als Ergänzung zu anderen Therapieformen genützt werden soll. Dieser Meinung stimme ich zu und bette Brainspotting beispielsweise in systemische Ansätze bzw. in die Psychodynamisch imaginative Traumatherapie (PITT) nach Luise Reddemann ein.
verwendete Literatur:
Fiedler, Peter (2013): Dissoziative Störungen. 2. Überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe Verlag.
Grand, David (2014): Brainspotting. Wie Sie Probleme, Traumata und emotionale Belastungen gezielt auflösen. Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
Gruber, Gerald (2012: Wenn Helden Hilfe brauchen. Peers im NÖ Feuerwehrwesen. Kommandantenfortbildung 2012. Baden bei Wien: ARBA Psychologische Betreuung.
Pankert, Christian; Gehrke, Anne (2015): Berufsbedingte Traumatisierung – Auslöser, Folgen, Präventionsangebote. In: Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, 2015 Heft 1. Köln: Asanger Verlag.
Schah, Hanne; Weber, Thomas (2015): Psychische Belastungen bei professionellen Helfern. In: Trauma- Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, 2015 Heft 2. Köln: Asanger Verlag.
Schubbe, Oliver (2006): Traumatherapie mit EMDR. Ein Handbuch für die Ausbildung. Institut für Traumatherapie Berlin. 4. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Schubbe, Oliver (2014): EMDR, Brainspotting und Somatic Experiencing in der Behandlung von Traumafolgestörungen. In: Psychotherapeutenjournal 2/2014, S. 156- 163.
Sendera, Alice; Sendera, Martina (2014): Trauma und Burnout in helfenden Berufen. Erkennen, Vorbeugen, Behandeln - Methoden, Strategien und Skills. Wien: Springer Verlag.
Shapiro, Francine; Kierdorf, Theo; Hör, Hildegard; Mallett, Dagmar (2012): Grundlagen und Praxis. Handbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen. 3. überarbeitete Auflage. XXX: Junfermann Verlag.
Teegen, Frauke., Domnick, A., & Heerdegen, M. (1997): Hochbelastende Erfahrungen im Berufsalltag von Polizei und Feuerwehr: Traumaexposition, Belastungsstörungen, Bewältigungsstrategien. Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 29(4), 583-599.
PTBS gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=YKgaCj8WwJ4

Sie erreichen mich unter:
Mobil: 0664 411 9229
e-mail: praxis@petra-preimesberger.com
meine barrierefreie Praxis befindet sich in der
Murhofstrasse 46
8111 Gratwein-Strassengel
Der mittlere Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite ist für Sie reserviert.
Gesundheitspsychologin
Eintragung am: 05.05.2011
Eintragungsnummer: 8247
Klinische Psychologin
Eintragung am: 05.05.2011
Eintragungsnummer: 8271
Zertifiziert durch: